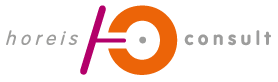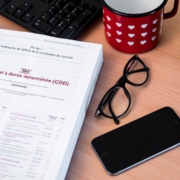Nun haben Beschäftigte gerade die Freiheit erlangt ganz oder teilweise die Aufgaben aus dem kuscheligen Zuhause oder von anderen Orten abseits des Firmensitzes zu erledigen, da kündigen insbesondere große Konzerne die geplante Rückkehr in die Firmenzentralen an. Diese Maßnahme würde absolut konträr gegenüber den Wünschen der Angestellten verlaufen. Laut einer Umfrage von McKinsey vom April dieses Jahres würden gerne 97% der Mitarbeitenden für den Rest ihrer beruflichen Laufbahn zumindest zeitweise on remote arbeiten wollen. Fakt ist, dass in Deutschland gerade einmal ein Viertel aller Erwerbstätigen zumindest gelegentlich im sogenannten Homeoffice gearbeitet haben (Statistisches Bundesamt 11.07.2023) und diese Flexibilität nicht mehr missen wollen.
Warum möchten die Menschen in der Wahl des Arbeitsort flexibel sein? Der Arbeitsweg fällt weg und damit lange Pendelzeit sowie hohe Spritkosten. Außerdem kann die Zeiteinteilung teilweise frei gewählt bzw. an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, es herrscht mehr Ruhe für konzentrierte Arbeiten, und es wird mehr Zeit für Familie und Freizeitaktivitäten gewonnen. Die Beschäftigten sind zufriedener, weniger ausgebrannt und erzielen bessere Arbeitsergebnisse – nach ihrer eigenen Einschätzung.
Und warum wollen die Firmen, die einst große Freiheit versprachen, die Belegschaft – ohne Rücksicht auf deren Bedürfnisse – teilweise unter Androhungen zurück ins Büro holen? Sicherlich war die Vorstellung, jeder könne von überall aus arbeiten, ohnehin eine Illusion. Und sicherlich hat sich manch Arbeitgeber dieser Illusion etwas zu naiv hingegeben, weil daraus schneller offene Stellen besetzt werden konnten. Doch es zeigen sich inzwischen offensichtlich Schwachstellen des hybriden Arbeitsortmodells. Die Innovationskraft lässt erwiesenermaßen nach, da Ideen u.a. im zufälligen Aufeinandertreffen von Personen während des Tages entstehen und vorangebracht werden. 35% der Ideen entstehen in Firmen am geliebten Kaffeeautomaten, was die Bedeutung des persönlichen Austauschs unterstreicht. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber, den Kollegen und den Aufgaben ist aus dem Homeoffice schwer erreichbar. Dieser Zustand kann zur Folge haben, dass das Unternehmen als Arbeitgeber austauschbar wird. In Bewerbungsgesprächen wird als zentrale Anforderungen an zukünftige Arbeitgeber formuliert, dass die zwischenmenschliche Ebene unbedingt passen soll und dass eine fundierte Einarbeitung gewünscht wird. Nur wie sollen Vorgesetzte diese Wünsche erfüllen, wenn die Hälfte der Belegschaft nicht vor Ort ist oder neue Mitarbeiter gar teilweise allein in der neuen Abteilung sitzen. Das fühlt sich nicht gut an. Die Folgereaktionen wie Flucht in Krankheit oder Kündigung sind leicht vorstellbar.
Flexibilität und hybrides Arbeiten werden schwerlich vom Markt verschwinden, bedürfen jedoch Regeln, damit der gegenseitige Austausch, das soziale Gefüge, Aus- und Weiterbildung und Zugehörigkeit gefördert werden. Die vielseits verabschiedete Maßnahme, an wieviel Tagen Anwesenheitspflicht besteht und an wie vielen anderorts gearbeitet werden kann, reicht nicht aus, um die Schwachstellen dauerhaft zu eliminieren. Es geht vielmehr um Vertrauen, die Bedürfnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Einklang zu bringen, so dass Ergebnisse und Ziele erreicht werden. Transformation der Arbeitswelt fängt im Unternehmen an, um die bestmöglichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche und zukunftsweisende Zusammenarbeit zu schaffen. Harte Ansagen oder Bevormundung werden jedenfalls niemanden ins Büro zurückholen.